7 Fragen an Christoph Meyer
Dr. Christoph Meyer ist seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Historische Normativitätsregime mit den Forschungsschwerpunkten Kirchenrecht, frühmittelalterliche Rechts- und Verfassungsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte des Hoch- und Spätmittelalters sowie Recht und Religion in der Vormoderne.
Was ist Ihre aktuelle Forschungsfrage und wie sind Sie zu dieser Frage gekommen?
Eine Frage, mit der ich mich seit einiger Zeit beschäftige, ist das Verhältnis von Recht und Text unter historischen Vorzeichen. Was mich interessiert ist also der Text als Medium des Rechts und seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung in der Vormoderne: Was konnte man aufgrund von Texten über das Recht wissen, und wie veränderte der Umgang mit Texten das Recht bzw. das Wissen über das Recht? Wie stellte sich der Text im Vergleich zu anderen Medien des Rechts dar? In was für einem Verhältnis steht der schriftlich fixierte Text zu rechtlichen Begriffen? Das sind nur einige wenige Facetten eines sehr vielschichtigen Themas. Die Frage nach Recht und Text wird gegenwärtig aus systematischer Perspektive vermehrt gestellt, ist aber keineswegs neu. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass oft ganz Unterschiedliches in diesem Zusammenhang betrachtet wird.
Was mich ursprünglich bewogen hat, mich mit dieser Problematik zu beschäftigen, war wohl nicht zuletzt eine alltägliche Erfahrung. Jeder, der sich mit einem rechtshistorischen Thema etwas eingehender befasst, kann die Beobachtung machen, dass der Inhalt einer Quelle, auf die etwa in Lehr- und Handbüchern Bezug genommen wird, sich bei genauerer Betrachtung mitunter anders darstellt, als man es aufgrund der Sekundärliteratur erwartet. Diese Diskrepanz, die unterschiedliche Ursachen haben kann, hat mich irritiert. Irgendwann wurde mir klar, dass diese Beobachtung in engem Zusammenhang damit steht, wie Rechtshistoriker mit ihren geschriebenen Quellen umgehen. Man muss sich einfach nur vor Augen halten, dass in einem nicht unerheblichen Teil der Sekundärliteratur Quellen und ihr Wortlaut bloß eine Nebenrolle spielen. Sie dienen oft nur dazu, mehr oder weniger publikumswirksam Theorien oder Konstruktionen des Verfassers zu belegen oder zu veranschaulichen. Als Ergebnis kommt dann in erster Linie das heraus, was man zuvor gedanklich hineingesteckt hat. Demgegenüber kann der Blick auf den Text zumindest bis zu einem gewissen Grad davor schützen, die Vergangenheit begrifflich in Gegenwart umzurechnen. Ausgehend von dieser Einsicht stellte ich mir dann irgendwann die Frage: Und wie gingen die Verfasser der Quellen mit ihren Texten um? Von da aus war es dann nur noch ein kleiner Schritt zum allgemeinen Verhältnis von Recht und Text unter historischen Vorzeichen.
Welche Vorgehensweise haben Sie zur Beantwortung dieser Frage gewählt?
Es würde zu weit führen, wenn ich versuchte, diese Frage hier en détail zu beantworten. Deshalb möchte ich nur auf drei Optionen hinweisen, die mir wichtig sind.
Eine erste Grundentscheidung ist methodischer Natur. Es wird wohl nicht weiter überraschen, wenn ich bekenne, dass für mich ein qualitativ-hermeneutischen Zugang zu Texten im Vordergrund steht. Anders ausgedrückt: Ich interessiere mich eher für ein close reading als für ein distant reading. Natürlich eröffnen die digital humanities für die Interpretation normativer Texte der Vormoderne interessante Möglichkeiten. Aber man sollte sich erst einmal mit dem Inhalt der Texte näher auseinandergesetzt haben, bevor man sie in den Kontext größerer Datenmengen oder digitaler Bibliotheken setzt.
Ein zweiter Punkt ließe sich vielleicht so umschreiben, dass mich der Text nicht in erster Linie als Medium interessiert, sondern in Hinblick auf seinen Inhalt. Wenn der Text ein Mittel oder Werkzeug ist, welche Rolle spielt er dann für die Erarbeitung und Verbreitung der Gegenstände, die in ihm behandelt werden?
Ein dritter Aspekt schließlich hängt eng mit den gerade angesprochenen Funktionen von Rechtstexten zusammen, und zwar vor allem mit ihrer Eigenschaft als Wissensspeicher. Allerdings muss ich gestehen, dass ich hier keine allgemeine Verhältnisbestimmung von Text und Wissen präsentieren kann, die ich bei meiner Arbeit durchgehend im Auge hätte. Ehrlich gesagt lassen sich meine Erkenntnisinteressen hier wohl nicht auf einen gemeinsamen Punkt bringen. Dennoch hat sich mir die Frage nach dem Wissen in Texten und über Texte immer wieder gestellt, etwa im Zusammenhang mit der Mnemotechnik, den Ordnungsvorstellungen oder in jüngerer Zeit in Hinblick auf die Epitomierung von Normtexten und kanonistischer Literatur.
Würden Sie sich selbst als Kanonisten mit dem Schwerpunkt Frühmittelalter bezeichnen? Wenn nicht, wie würden Sie sich selbst beschreiben und was hat Sie dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen? Bitte erzählen Sie uns ein wenig über Ihren akademischen Werdegang.
Als Kanonisten mit dem Schwerpunkt Frühmittelalter würde ich mich sicher nicht beschreiben. Mein rechtshistorisches Interesse gilt dem kanonischen Recht wie auch dem weltlichen Recht. Soweit es das weltliche Recht angeht, liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit im Frühmittelalter, und zwar vor allem im Bereich der sog. Leges barbarorum oder Volksrechte, die traditionell besonders mit den Germanen in Verbindung gebracht werden. Für das Kirchenrecht liegt mein Augenmerk dagegen auf dem zweiten Jahrtausend. Hier hat mich zunächst und bis heute vor allem das kanonische Recht des Hoch- und Spätmittelalters interessiert. In den letzten Jahren ist dann das katholische Kirchenrecht der Frühneuzeit hinzugekommen.
Nun zu meinem akademischen Werdegang. Am Anfang stand wohl vor allem das Interesse am Kirchenrecht und an seiner Geschichte. Ich hatte in Münster mit einem Studium der Fächer Geschichte, Theologie und Philosophie begonnen und mich schon sehr bald für die kirchliche Rechtsgeschichte interessiert. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass mir das fachliche Rüstzeug fehlte, um mich damit wirklich adäquat befassen zu können. Ich wollte daher kanonisches Recht als eigenes Fach studieren und mir zuvor eine belastbare Grundlage im römischen Recht verschaffen, ohne das man das mittelalterliche Kirchenrecht nicht richtig verstehen kann. Das führte mich 1988 nach Oxford, wo man sich damals als Undergraduate sehr intensiv mit römischem Recht beschäftigen konnte. Nachdem ich dort das Diploma in Legal Studies erworben hatte, kehrte ich zunächst zurück nach Münster. Von dort ging ich dann 1990 an die Universität Leuven, an der ich im Laufe der Jahre das Bakkalaureat, das Lizentiat und schließlich 1995 das Doktorat im kanonischen Recht erwarb. Vor und nach meiner Promotion war ich erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Heinz Holzhauer (Universität Münster) und dann seit 1999 als Assistent bei Harald Siems (Universität Erlangen-Nürnberg) tätig und hatte Stipendien der Görres-Gesellschaft und des Historischen Kollegs in München, bevor ich schließlich 2009 nach Frankfurt kam.
Welches Buch oder welche Person hat Ihre persönliche oder akademische Entwicklung besonders beeinflusst und warum?
Wenn ich diese Frage einmal auf das Themengebiet von Recht und Text beziehen darf, dann fällt mir vor allem dreierlei ein. Da ist zunächst eine Vorlesung zum römischen Deliktsrecht von Tony Honoré, die ich während meines Studiums in Oxford besuchte. Ich hatte in Deutschland schon Vorlesungen im römischen Recht gehört und Lektürekurse zu lateinischen Rechtsquellen besucht, aber eine so intensive und geistreiche Auseinandersetzung mit Texten des römischen Rechts, davon war ich wirklich überrascht. Wozu so etwas dienen sollte oder konnte, war mir damals allerdings nicht klar. Beeindruckt hat es mich aber sehr. Größeren Einfluss hatte auf mich sicherlich das Interesse, das in Münster in den späten 1980er und den 1990er Jahren ganz allgemein dem Phänomen der Schriftlichkeit unter historischen Vorzeichen entgegengebracht wurde, wenn man etwa an den Münsteraner Sonderforschungsbereich zur pragmatischen Schriftlichkeit im Mittelalter denkt, der von 1986-1999 bestand. Im Zusammenhang mit diesem allgemeinen Interesse an Fragen der Schriftlichkeit stand irgendwann Anfang der 1990er Jahre meine Begegnung mit Ivan Illichs „Im Weinberg des Textes“. Auch wenn mir der streckenweise etwas larmoyante Ton des Buches nicht gefiel, vermittelte es mir doch ein Problembewusstsein für die Bedeutung von Text und Textgestaltung im Zeitalter der Scholastik. So gesehen hat Münster für mein Interesse an Recht und Text sicher eine wichtige Rolle gespielt. Im Vergleich zu den Münsteraner Ausgangspunkten haben sich meine Interessen allerdings im Laufe der Zeit von den formalen Aspekten etwas stärker in Richtung der Inhalte verschoben. Das hängt wohl auch mit meiner Assistentenzeit bei Harald Siems zusammen, der mir wichtige Impulse für meine Arbeit als Rechtshistoriker gegeben hat. Das gilt etwa für die Frage, wie ich mich historischen Rechtsquellen nähere und welche inhaltlichen Einsichten ich ihnen abgewinnen kann, aber auch für das Verhältnis zur rechtshistorischen Sekundärliteratur.
Was ist für Sie die größte Herausforderung als Wissenschaftler in Ihrem Fachgebiet? Können Sie uns eine Erfahrung aus der Vergangenheit schildern, aus der Sie gelernt haben?
Ganz gleich, ob man sich mit dem kanonischen Recht oder mit den Leges beschäftigt, eine zentrale Herausforderung besteht in meinen Augen in dem, was man als Entwicklung einer eigenen Fragestellung umschreiben könnte. Das zeigt sich besonders dann, wenn man sich mit dem Recht des frühen und hohen Mittelalters beschäftigt. Völlig unbekannt ist hier kaum etwas. Manchmal haben sich Forscher bereits seit zwei Jahrhunderten mit einem Gegenstand beschäftigt, wenn er aus was für Gründen auch immer in unser Blickfeld rückt. Natürlich liegt es nahe, Fragen, die uns heute bewegen, in der einen oder anderen Form an den Gegenstand heranzutragen. Die eigentliche Herausforderung besteht aber wohl darin, unser notwendigerweise gegenwartsbezogenes Erkenntnisinteresse in Fragen an die Quellen zu übersetzen, die nicht anachronistisch, sondern sachgemäß sind, so dass die historischen Rechtstexte darauf eine Antwort geben können. Dabei muss unsere Fragestellung natürlich auch das berücksichtigen, was frühere Untersuchungen über den Gegenstand bereits zu Tage gefördert haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn ich die Sekundärliteratur in meinem Forschungsgebiet lese, habe ich oft den Eindruck, dass viele Autoren aktuelle Diskussionen sehr wohl im Blick haben, aber ihnen völlig entgangen ist, dass so manches, was sie als neue Erkenntnis verkaufen, schon im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert beobachtet worden ist. So wird dann etwas, was eigentlich schon längst bekannt ist, noch ein drittes oder viertes Mal entdeckt.
Was nun die Erfahrung aus der Vergangenheit betrifft, so erinnere ich mich u. a. an die Schwierigkeiten, die ich im Zusammenhang mit einer Tagung hatte, auf der ich über Öffentlichkeit und Recht im späten Mittelalter sprechen sollte. Probleme bereitete mir dabei vor allem der moderne Begriff der Öffentlichkeit, der stark ideologisch aufgeladen ist und seit dem 18. Jahrhundert vielfältige Legitimationsfunktionen hat. Ich war mir ziemlich sicher, dass sich die moderne Erfolgsgeschichte der Öffentlichkeit, die sich vor allem um die kommunikative Seite des Phänomens dreht, nicht in das Spätmittelalter zurückverfolgen ließ. Auf der anderen Seite ging es aber auf der Tagung nun einmal um Öffentlichkeit. Was also tun? Ich entschied mich schließlich, über einen bereits im Mittelalter zu beobachtenden Teilaspekt von Öffentlichkeit zu sprechen, und zwar ihre soziale und rechtliche Funktion. Das entsprach wohl nicht ganz der Blickrichtung der Tagung und den Intentionen der Veranstalter, erlaubte mir jedoch, mit dem Quellenmaterial, das mir zur Verfügung stand, halbwegs sinnvolle Antworten auf die Frage nach Öffentlichkeit zu geben.
Wie würden Sie die Hauptaufgabe (oder das Berufsbild) eines Rechtshistorikers beschreiben und welche Werte sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten, die er oder sie in seine Tätigkeit einbringen sollte?
Die vorrangige Aufgabe eines Rechtshistorikers besteht darin, die Geschichte des Rechts zu untersuchen. Das geht nur, wenn man seine Quellen erforscht. Dazu bedarf es eines Vorwissens, und damit sind wir auch schon beim Problem der „Werte“. Man kann sich das leicht klarmachen, wenn man mit Sekundärliteratur aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert arbeitet. Das, was sich an älterer Literatur heute noch zu lesen lohn, sind für gewöhnlich Untersuchungen, deren Autoren mehr an den Quellen als an der Reproduktion ihres Vorwissens im Spiegel der Quellen interessiert waren. Diese alltägliche Erfahrung spricht aus meiner Sicht für eine grundsätzliche Vorsicht gegenüber unseren eigenen Gewissheiten, ganz gleich um was für Dogmatiken oder Weltanschauungen es sich handelt. Anders gesagt: Man darf sich die Gegenwart nicht zu sehr zum Freund machen, sonst konsumiert sie die Geschichte. Ich will das nicht dramatisieren. Wenn wir die Rechtsgeschichte erforschen und dabei von Gerechtigkeits- und Rechtsvorstellungen unserer eigenen Zeit ausgehen, dann ist das zunächst einmal naheliegend. Problematisch wird es aber dann, wenn wir aus der Not eine Tugend machen und Kategorien oder Vorstellungen, die für uns heute zentral sind, gezielt benutzen, um die historische Überlieferung vorzugsweise durch diese Brille betrachten zu können, und so zur Legitimation der entsprechenden Aspekte oder Normen unserer Gegenwart beitragen. Das ist sicherlich ein Grundproblem historischen Arbeitens. Aber es hat in den letzten Jahrzehnten, wie mir scheint, aus verschiedenen Gründen an Brisanz gewonnen. Ein Grund liegt in einem Bedeutungsverlust der Geschichte, wenn man etwa an den unterschiedlichen Stellenwert denkt, den sie im 19. Jahrhundert und heute in der allgemeinen Wahrnehmung hatte bzw. hat. Da kann schon der Gedanke naheliegen, einen rechtshistorischen Gegenstand auf die eine oder andere Art und Weise zu aktualisieren und ihn so scheinbar „relevanter“ zu machen. Doch kommt noch etwas Anderes hinzu. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Medien- und Publikationskultur stark verändert. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass heute der Meinung oder Perspektive im Vergleich zu den Fakten größere Bedeutung zukommt. Vor diesem Hintergrund sinkt die Bereitschaft, sich im Reden oder Schreiben über die Vergangenheit von dem ohnehin immanenten Gegenwartsbezug freizumachen. Ich denke dabei weniger an explizite Bewertungen. Problematisch erscheinen mir nicht zuletzt die in immer kürzeren Abständen propagierten „Turns“, die unsere Wahrnehmung der Vergangenheit auf einen vermeintlich entscheidenden Blickwinkel zurechtstutzen, so dass irritierende historische Befunde, die nicht in unser Bild von der Welt passen, zunehmend außen vor bleiben.
Wenn Sie kein Rechtshistoriker wären, was würden Sie dann gerne werden?
Das ist eine interessante Frage, zu der mir, wenn ich ehrlich sein soll, gegenwärtig nichts einfällt. Sollte ich irgendwann in der Zukunft noch einmal von Ihnen interviewt werden, kann ich darauf vielleicht eine Antwort geben.
Das Interview führte Alexandra Woods.
Cite as: Meyer, Christoph: “Man darf sich die Gegenwart nicht zu sehr zum Freund machen, sonst konsumiert sie die Geschichte.”, legalhistoryinsights.com, 15.06.2021, https://doi.org/10.17176/20210628-142206-0
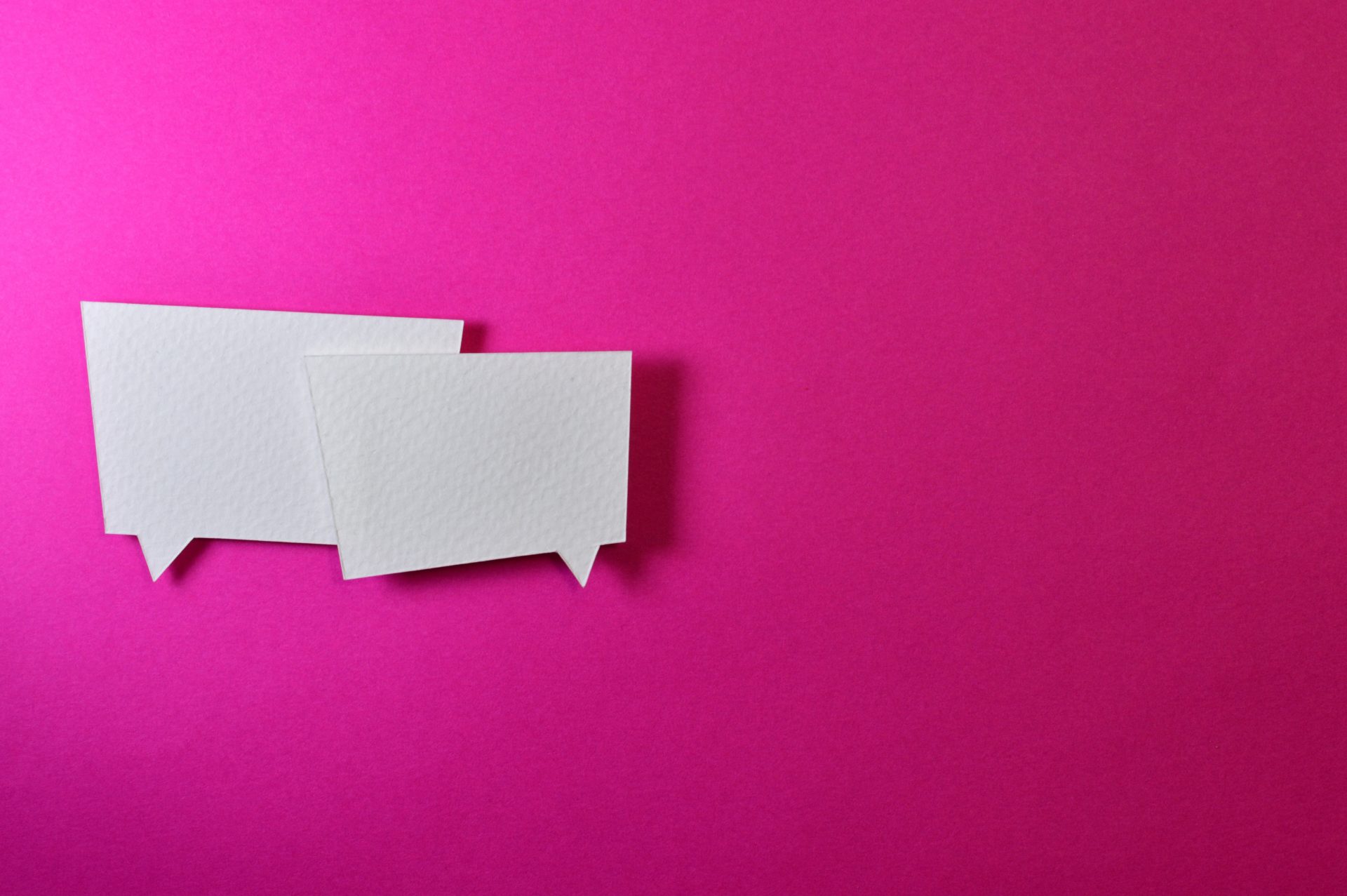

 This work is licensed under a
This work is licensed under a 