7 Fragen an Peter Collin
PD Dr. Peter Collin ist seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Historische Normativitätsregime mit den Forschungsschwerpunkten in der Rechtsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere in der Geschichte des öffentlichen Rechts, Wirtschaftsrechtsgeschichte, Verwaltungsgeschichte, und Justizgeschichte.
Was ist Ihre aktuelle Forschungsfrage?
Derzeit untersuchen wir die Regelung der Arbeitsbeziehungen in der Metallindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts. Das kein Forschungsvorhaben nur von mir allein, sondern das Projekt einer Gruppe, zu der als Wissenschaftler die Kultur- und Sozialhistorikerin Johanna Wolf und von Seiten der Digital Humanities Andreas Wagner gehören. In dem Projekt es weniger um staatliches Gesetzesrecht. Im Vordergrund stehen vielmehr Arbeitsordnungen, Tarifverträge, Betriebskassenstatuten, Streikversicherungsreglements, Verhaltensregeln für Betriebsräte usw., also nichtstaatliche Normen. Wir wollen herausfinden, wie sich eigenständige normative Ordnungen unterhalb der Ebene des Gesetzes herausgebildet haben und welches Zusammenspiel es zwischen diesen Ordnungen und der Welt des staatlichen Rechts gab. Letztlich geht es auch darum zu zeigen, dass die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht nur aus Konflikten bestanden, sondern dass auch Etliches über Koordination oder sogar Kooperation ablief. Das ist allerdings mit rechtshistorischer Expertise nicht allein zu bewältigen. Deswegen auch die Zusammenarbeit mit der Sozial- und Kulturgeschichte.
Welche Vorgehensweise haben Sie zur Beantwortung dieser Frage gewählt?
Wir sammeln für einige Regionen systematisch die oben genannten Regelwerke. Im Moment ist das wegen der coronabedingten Beschränkungen des Archivzugangs sehr schwierig, aber mehrere Hundert sind bis jetzt schon zusammengekommen. Und wir hoffen, dass wir ab dem Frühjahr mit voller Kraft mit der Sammlung der Quellen weitermachen können. Diese werden dann in eine digitale Form überführt und die Gesamtdokumente wie auch einzelne Regelungsaussagen werden mit Metadaten versehen. Wenn das geschehen ist, lassen sich dann alle Bestimmungen beispielsweise zum Thema Akkordlohn oder Arbeitszeitregelung zusammenführen. Das kann man dann noch mal verfeinern, zum Beispiel nach Regionen, Zeiträumen, einzelnen Branchen innerhalb der Metallindustrie usw. Im Ergebnis haben wir dann eine Quellenedition, die Regelungstrends und Regelungsschwerpunkte erkennbar macht. Wir können dann aber auch sehen, ob ein bestimmtes Niveau der Regelungstechnik ein Ausreißer oder allgemeiner Standard war und gegebenenfalls, ob sich diese Regelungstechnik von einer bestimmten Region oder Branche aus verbreitet hat. Wir rekonstruieren also eine Rechtsordnung außerhalb des staatlichen Rechts nicht nur als statische Ordnung, sondern auch in ihrer Dynamik. Das sind jedenfalls die Erwartungen. Wie aussagekräftig das ist, hängt vor allem von der Zahl der Regelwerke ab, die wir noch erschließen müssen, und auch davon, welche Kontextinformationen zur Verfügung stehen.
Auf welchem Weg sind Sie zu ihren heutigen Forschungsthemen gekommen? Wie würden Sie das in Ihren akademischen Werdegang einordnen?
Als ich am Max-Planck-Institut angefangen hatte, beschäftigte ich mich vor allem mit dem Thema „Regulierte Selbstregulierung“. Dabei geht es darum, dass Private in bestimmten Bereichen, die auch öffentliche Angelegenheiten betreffen, eigene Regelungsfreiräume haben. Der Staat beschränkt sich darauf, diese in mehr oder weniger starkem Maße durch Rahmengesetze oder Aufsicht zu beeinflussen. Das ist ein Thema, was bis dahin vor allem in der Rechts- und Politikwissenschaft behandelt worden war, also als Phänomen der Gegenwart. Man findet aber ähnliche Konstellationen auch schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Ein Projekt, dass danach kam und das mich immer noch beschäftigt, befasst sich mit Schiedsgerichten, aber nicht mit den normalen privaten Schiedsgerichten, sondern mit staatlichen oder halbstaatlichen, die in starkem Maße mit nichtstaatlichen Entscheidern besetzt sind. Hier geht es, wenn man das so vereinfacht sagen kann, um justizielle regulierte Selbstregulierung. Und dann kam der Gedanke auf, eine umfassende Tiefenbohrung vorzunehmen, also nicht nur die Strukturen, sondern auch systematisch die Ergebnisse derartiger Selbstregulierung zu erschließen. Dazu muss man aber in großem Umfang das Regelungsmaterial erschließen, was gar nicht so einfach ist, weil es sich eben nicht leicht zugänglich in Gesetzessammlungen findet, sondern verstreut in einer Vielzahl von Archiven oder in Separatdrucken in Bibliotheken. Da Gerd Bender an unserem Institut zusammen mit dem Hugo-Sinzheimer-Institut eine Arbeitskreis „Arbeitsrechtsgeschichte“ initiiert hatte, ergaben sich von dieser Seite aus Kooperations- und Fördermöglichkeiten, was schließlich dazu führte, dass dieses jetzige Projekt entstand.
Wenn ich das in eine große Linie meines akademischen Werdegangs einordnen sollte, würde ich sagen, dass ich erst eher vom öffentlichen Recht kam und die verwaltungsrechtshistorische Perspektive dominierte und dann aber immer mehr in eine Art Zwischenreich geriet, wo es diese traditionelle Zuordnung zu Privatrecht oder öffentlichem Recht zwar noch gibt, aber das dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Das ist keine neue Erkenntnis, schon die Zeitgenossen haben auf diese Mischungen hingewiesen. Aber in der bisherigen rechtshistorischen Forschung ist dieses Thema ein wenig unterbelichtet geblieben.
Welches Buch oder welche Figur hat Ihre persönliche oder akademische Karriere besonders beeinflusst und warum?
Am Anfang haben mich maßgeblich vor allem drei Bücher beeinflusst: Eberhard Schmidts „Einführung in die Geschichte der Strafrechtspflege“, Franz Wieackers „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“ und die „Geschichte des öffentlichen Rechts“ von Michael Stolleis. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Werke und die ersten beiden waren ja schon zu der Zeit, in der ich sie las, teilweise von der modernen Forschung überholt. Aber darum geht es auch nicht. Wenn man ganz am Anfang steht, ist es sowieso nicht so wichtig zu wissen, was im Detail forschungsmäßig auf dem neuesten Stand ist. Wichtig ist – das war jedenfalls bei mir so -, etwas zu lesen, was einen gewissermaßen reinzieht. Und das konnten diese Bücher mit ihrer eingängigen, suggestiven bzw. eleganten Darstellungsweise. Wenn man erst einmal derart „angefixt“ ist, kommt dann auch alles Weitere.
Wenn ich auf ein Buch verweisen soll, dass mich gegenwärtig fasziniert, fällt mir gerade das über Maria Theresia von Barbara Stollberg-Rillinger ein. Das hat zwar nicht direkt etwas mit meinen aktuellen Forschungsarbeiten zu tun, aber es zeigt doch auf eindrucksvolle Weise, wie Staat und Verwaltung in einer eigentlich ganz fremden Welt funktionieren. Vieles was dort ablief, würde man nach heutigen Maßstäben als korruptiv und willkürlich ansehen. Schon im 19. Jahrhundert wäre das gar nicht mehr so gegangen. Aber damals war es normal und hatte seinen Sinn. Das Verständlichmachen dieser Fremdheit fand ich so beeindruckend. Und es machte mir noch einmal den gewaltigen Bruch deutlich, der sich ab Beginn des 19. Jahrhunderts vollzog.
Was ist für Sie die größte Herausforderung als Wissenschaftler in Ihrem Fachgebiet? Können Sie uns eine Erfahrung aus der Vergangenheit schildern, aus der Sie gelernt haben?
Als ich als Doktorand anfing, hieß es, dass ein Rechtshistoriker einen Tisch, einen Stuhl, Papier, einen Stift und seine Quellen benötigt. Ob das eine zutreffende Aussage für die damalige Zeit war, sei dahingestellt. Aber man sieht schon, dass sich gewaltig etwas geändert hat und das ist auch für mich eine erhebliche Herausforderung. Das betrifft vor allem zwei Dinge:
Erstens die Internationalisierung der Forschung. Das geht natürlich mit erheblichen Schwierigkeiten einher. Zum einen die sprachliche Verständigung auf einem wirklich wissenschaftlichen Niveau, zum anderen aber auch die inhaltliche Seite. Und das betrifft gerade die Rechtsgeschichte, die ja trotz aller Verflechtungen stark national geprägt ist – bis in die Terminologie hinein. Das gibt einem manchmal das Gefühl, dass man eigentlich nicht viel beitragen kann, selbst wenn es das eigene Thema betrifft. So kann ich zwar einiges sagen, was die Regulierung von Kreditgenossenschaften in Deutschland angeht. Wenn man mit einem brasilianischen Kollegen zu tun hat, der das Gleiche in Brasilien untersucht, ist es schwierig, sich dann fachlich zu verständigen, weil die Regelungen und vor allem der Regelungshintergrund zum Teil völlig unterschiedlich sind. Das eigentliche Fachsimpeln, was ja eine gemeinsame Vertrautheit mit Details voraussetzt, fällt weitgehend weg. Auf der anderen Seite habe ich unheimlich viel gewonnen dadurch, dass im Gespräch mit jenen, die andere Rechtskulturen untersuchen, auch eigene eingefahrene Denkmuster in Frage gestellt werden. Zum Teil hatte ich dabei auch schon richtige Aha-Erlebnisse. Aber es ist eben sehr voraussetzungsvoll und verlangt auch ein Ausbrechen aus eingespielten Routinen
Die zweite Herausforderung ist die Technik. Auch für die Rechtsgeschichte ergeben sich so viele Möglichkeiten, mittels IT Dinge in neuartiger Weise zu untersuchen und darzustellen. Aber sobald das ein gewisses Level übersteigt, ist man doch auf externe Expertise angewiesen. Das ist dann auch der Vorteil größerer Institutionen, die die entsprechenden Ressourcen haben, wie eben unser Institut. Mit den Mittel normaler Universitätslehrstühle lässt sich das viel schwieriger bewerkstelligen. Aber wenn ich in dem Zusammenhang von einer Erfahrung berichten soll, von der ich gelernt habe, kann ich auch auf viel Banaleres verweisen: Lange Zeit habe ich versucht, soviel wie möglich auf Papier und nicht auf dem Bildschirm zu lesen. Das Ergebnis waren irgendwann lange Reihen von Ordnern mit Kopien, wobei für mich dann oft auch nicht mehr nachvollziehbar war, in welchem Ordner sich welche Kopien befinden. Irgendwann habe ich dann angefangen, alles als PDF zu speichern und lese Aufsätze grundsätzlich nur noch auf dem Bildschirm.
Wie würden Sie die Hauptaufgabe (oder das Berufsbild) eines Rechtshistorikers beschreiben und welche Werte sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten, die er oder sie in diese Rolle einbringen sollte?
Ich finde beide Fragen sehr schwierig. Die erste, weil man sich dabei in ein klassisches Dilemma begibt, über das schon viel diskutiert wurde und zu dem ich eigentlich auch nichts Neues beitragen kann: Soll sich ein Rechtshistoriker als Jurist verstehen und mit seiner Arbeit zum Verständnis des Rechts beitragen oder soll er sich als Historiker begreifen, für den es zum Verständnis der Vergangenheit eher hinderlich ist, wenn das geltende Recht als relevant in seinem Hinterkopf herumspukt. Ich würde einfach sagen: Es kommt darauf an – und zwar auf den Untersuchungsgegenstand, die konkrete Fragestellung, Also im Ergebnis würde ich hier für einen gewissen Pluralismus plädieren. Was die Werte betrifft, ist meines Erachtens die Offenheit für das Fremde sehr wichtig. Denn die Vergangenheit ist ja immer fremd.
Wenn Sie kein Rechtshistoriker wären, was würden Sie dann gerne werden?
Als Jurist im geltenden Recht könnte ich mir gut vorstellen, mich auf ein bestimmtes Gebiet zu spezialisieren, auf dem man dann auch sinnvoll mitreden kann.
Das Interview führte Alexandra Woods.
Cite as: Collin, Peter: “… ist meines Erachtens die Offenheit für das Fremde sehr wichtig. Denn die Vergangenheit ist ja immer fremd.”, legalhistoryinsights.com, 21.06.2021, https://doi.org/10.17176/20210628-142530-0

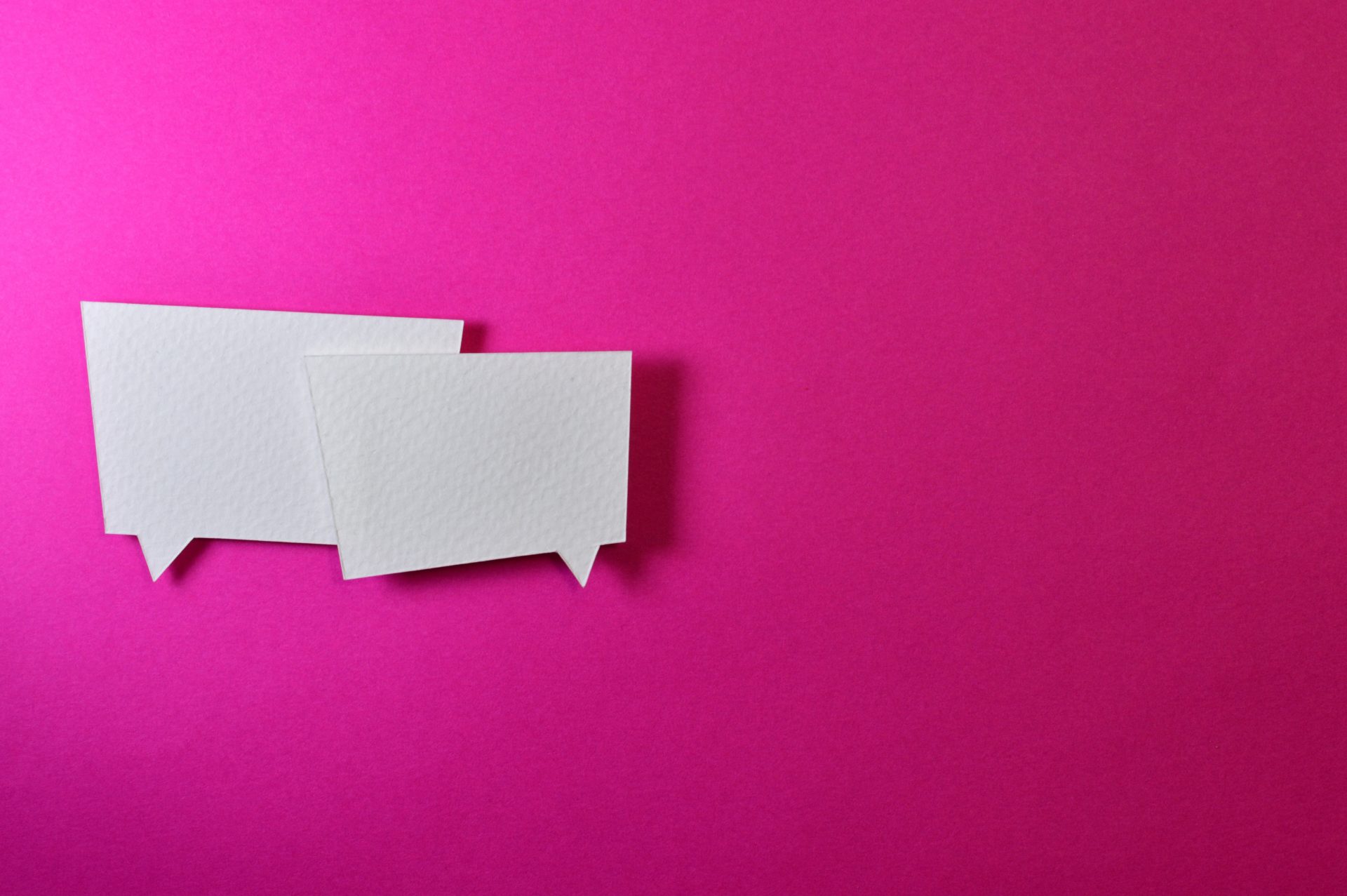

 This work is licensed under a
This work is licensed under a 